 Verlagsprogramm Bücher
Verlagsprogramm Bücher
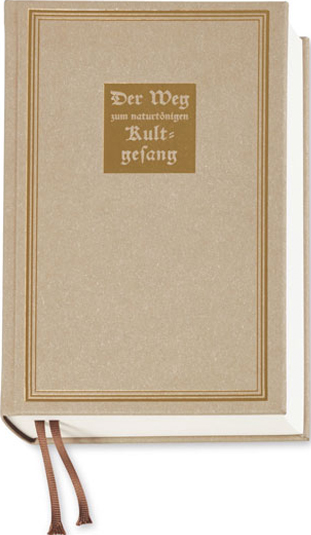
Der Weg zum naturtönigen Kultgesang
Das musikalische System des deutschen orthodoxen Kirchengesangs, seine
geistigen und geschichtlichen Voraussetzungen, seine Symbolik und die
harmonikale Struktur der Obertöne. Musikalisch-philosophisches Lehrbuch von
Archimandrit Johannes, Abt von Buchhagen.
„Es geht darum, sich nicht durch abstrakte technische Formen und Normen determinieren zu
lassen – mag solcherart homogenisiertes Material auch noch so bequem zu handhaben sein –
sondern schlicht die Töne zu singen, die Gott selbst geschaffen hat ...“ (Altvater Johannes von
Buchhagen)
Der naturtönige Kultgesang bildet eine Brücke zu den Ursprüngen der Musik
schlechthin und könnte heute, nach dem Ende der Moderne, zum Paradigma einer
neuen Beziehung zwischen Mensch und Schöpfung werden.
Das Buch erläutert, für jedermann verständlich und nachvollziehbar, die
Prinzipien des sakralen Gesangs, die Grundlagen der Harmonik sowie den
Zusammenhang zwischen akustischen Phänomenen, Musik, Seele und Geist. Es
stellt die klassischen Stimmungs- und Tonsysteme vor, die in der europäischen
Geschichte eine Rolle gespielt haben und zeigt den Zusammenhang zwischen
Musikausübung und sittlicher Bildung auf. Anhand der musikalischen, historischen
und Schöpfungsgegebenheiten werden erkenntnistheoretische, anthropologische
und metaphysische Hintergründe erörtert, deren Durchdringung nicht zuletzt zu
einem angemesseneren Verhältnis zur Schöpfung, zum Mitmenschen und zum
dreieinen Gott führt, zu einem anderen „Modus“ im Umgang mit den Dingen ...
Die Harmonik als Wissenschaft befaßt sich mit den ganzzahligen Strukturbildungen in der Natur. Aus ganzzahligen Teilungsverhältnissen der Wellenlänge
eines Grundtones entstehen auch die reinen Naturintervalle. Diese Zusammenhänge verweisen auf das, was Altvater Johannes ein „Bildegesetz der
Schöpfung“ nennt. Schon in der Antike, und noch bei den frühen Kirchenvätern, gehörte die Erforschung der Zahlenzusammenhänge in der Musik, in
Physik, Biologie, Architektur, Kunst und Religion zur höheren Bildung (μάθησις). Sie war Grundlage des allgemeinen Weltbildes wie auch der Philosophie,
wenn sie freilich auch in manchen ihrer Teile – als echte esoterische Disziplin – Arkanum blieb. In der Neuzeit galt sie als „veraltet“, ehe sie durch Albert v.
Thimus und insbesondere Hans Kayser wiederentdeckt wurde und in unseren Tagen durch die Entwicklungen der Mikrophysik neuen Auftrieb erhielt.
Wohl gab es seither manche Ansätze, physikalisch-mathematische Phänomene (Fraktale, Planetenbahnen) in Klänge umzusetzen, auch fehlt es nicht an
philosophischen Reflexionen zum Thema. Aber für Komponisten und praktische Musiker sind Naturtöne und harmonikale Ableitungen von Tonstufen
bisher kaum ein Thema gewesen.
Von der Tradition des byzantinischen Kirchengesangs herkommend war das Tonsystem des Deutschen Chorals im Dreifaltigkeitskloster seit jeher naturtönig
angelegt. Daraus hat sich aufgrund der geistigen Erfordernisse und Erfahrungen liturgischen Betens in den Jahrzehnten seit der Klostergründung ein
ästhetisches Ideal entwickelt, welches eine gründlichere Beschäftigung mit den Fragen der Feinstimmung erforderlich machte.
Über Jahre hinweg wurden in langen Versuchsreihen hunderte harmonikaler Tonverhältnisse auf Erkennbarkeit, musikalische Wirkung und geistige
Wertigkeit hin untersucht, musikalisch erwünschte Tonstufen technisch ausgemessen und für die Theourgie geeignete naturtönige Skalen in der
Gesangspraxis erprobt. Daran schließen sich Betrachtungen zur Symbolik des Kirchengesangs, zur Symbolik der Intervalle und musikalischen Gesten, ihren
Wirkungen, und zur Frage nach den damit verbundenen geistigen Kräften im Sinne des heiligen Dionysios des Areopagiten.

S. 50
Die Analogien zur Wohlordnung des Obertonspektrums sind unglaublich. Man könnte meinen, die Gesetzmäßigkeiten der natürlichen Intervalle und
das Lambdoma seien als Unterrichtsmaterial zur Veranschaulichung der dionysianischen Kosmologie und Philosophie entwickelt worden. Was er über das
Verhältnis der 1 zu allen anderen Zahlen sagt, ist im Zeugerton 1/1 unmittelbar abgebildet. Es bezieht sich auf das Hervortreten alles Seienden aus dem
göttlichen Seinsursprung, der in Jesus Christus Fleisch geworden ist und daher in Ihm verherrlicht wird. Und dieser ist es, der wiederum in den Dingen der
Schöpfung geistig erkannt wird, insofern er das Ewige Wort und selber in Gott und Gott ist, wie oben ausgeführt. Wenn der hl. Dionysios dann im
Folgenden alle denkbaren Begriffe überwindet und einen nach dem anderen abstreift, und noch den Begriff des Einen hinter sich läßt um zum Übersein
aufzusteigen, sodann von Gott als dem unsagbaren Urgrund spricht, der über allem Sein und Nichtsein erhaben ist, zerstört er die Begriffe, die er vorher so
sorgsam entwickelt hat. Er zerstört sie aber, um uns aus den Schlingen der Abstraktion zu ziehen, welche jederzeit aus dem Versuch philosophischer
Annäherung an Gott eine abgehobene, rein begriffliche (spekulative) Angelegenheit ohne jeden mystagogischen Wert zu machen droht, und zugleich uns auf
die unmittelbare Erkenntnisweise zu verweisen, welche jenseits der fleischlichen Seelenkräfte, Denken und Empfinden, durch jenes „Erkenntnisorgan“
geschieht, welches wir als geistige Vernunft, geistige Erkenntniskraft oder einfach als Geist (νοῦς) bezeichnen. Der irrationale Wert 0/0 ist eine wunderbare
Hieroglyphe der allüberschreitenden Jenseitigkeit Gottes. Aber Dionysios wäre nicht der große Mystiker und heilige Altvater, höbe er nicht auch noch die
Zahl als Begriff und Hieroglyphe auf und verwiese er uns nicht mit unbeirrbarer Sanftheit immer wieder auf die Notwenigkeit der unmittelbaren geistigen
Schau. Selbst als Hieroglyphen bleiben die Zahlen der Beschränkung des Irdischen unterworfen. Nicht die Zahlenverhältnisse, sondern erst die tatsächlich
musikalisch erlebten Naturintervalle stellen die lebendige Beziehung zu den urbildlichen Gegebenheiten her, von denen dann auch die Zahlen ihr Leben und
ihre Bedeutung beziehen. Daher sagt der hl. Dionysios, daß die Zahlen „nur“ Anteil haben am Sein, aber selbst nicht Ursein sind. In den
schwindelerregenden Höhen geistiger Schau und deren philosophischer Reflexion, in denen sich seine Ausführungen bewegen, ist solche Sorgfalt der
Unterscheidung und Wertung unerläßlich, um auf allen Ebenen das Gleichgewicht zu wahren und nicht in abstrakte Spekulation abzugleiten. In diesem
ausgewogenen Sinne muß das Lambdoma „gelesen“ werden.
S. 86
Durch den Sündenfall, die Trennung von Gott, sind all unsere menschlichen Maße und Vorstellungen nur bedingte, wie gebrochen durch den
Schleier der stofflichen Erscheinung und verschatteter Wahrnehmung. Dadurch geschieht es, daß Dinge und Menschen als etwas erscheinen können, was sie
nicht sind, und daß oft nicht erkannt wird, was ist, sondern Trug für Wahrheit gilt und Wahrheit für Trug. Die Kraft des rationalen Verstandes führt wohl zu
Begriffen und Maßen, aber weil sie am Schein und nicht am Sein sich festmachen, sind sie bedingt, sagen nur im Verhältnis zu unserem eigenen Bewußtsein
und unseren Setzungen etwas aus. Der rationale Begriff zumal, der von der sinnlichen Erscheinung abgezogen (abstrahiert) wird, ist zwar bequemer zu
handhaben als die Wirklichkeit, ist aber vom göttlichen Urbild noch weiter entfernt als die sinnliche Erscheinung in all ihrer Vielschichtigkeit, zu der eben ihr
Bildsein und Symbolwert unbedingt hinzugehören. Daßelbe gilt, in ähnlicher Weise, für unsere Gefühlsempfindungen, solange wir nicht von aller
Selbstbezogenheit und aller Anhaftung an das, was nicht Gott und nicht Gottes ist, gereinigt und zur reinen Herzensschau fähig geworden sind. Erst wenn
die andere Seite hinzukommt, was wir die geistige Schau nennen, und wenn Erkenntnis des Wesens der Dinge geschieht, sehen wir die Dinge, wie sie
wirklich sind, und das heißt, wie sie vor Gott erscheinen. Daher sagt Paulus: „Denn all unser Wissen ist Stückwerk ... wenn aber das Vollkommene kommen
wird, wird auch das Stückwerk aufhören.“ Solche Erkenntnis freilich ist nur möglich in der Liebe, denn es gibt keine Erkenntnis außer der Liebe, und es gibt
keine Liebe außer der Erkenntnis. Beide, Liebe und Erkenntnis sind wiederum nur in Gott und durch Gott möglich, genauerhin durch die Gnade und Kraft
des Heiligen Geistes, und beide sind etwas sehr anderes als ihre bloße Behauptung. Auch hier gibt es keine Ausnahme von dem allgemeinen Gesetz, daß
Bewußtsein, im Augenblick, da es in geistiger Schau die Grenze zu den Urbildern überschreitet, selbst gewandelt und Überbewußtsein wird.
Auf das musikalische Empfinden angewandt heißt das: solange es sich noch allein auf die abstrakten Maße und Regeln gründet oder in gefühligem
Behagen oder Mißbehagen sich erschöpft, ist es uneigentlich, äußerlich, ohne Erkenntnis und Wahrheit. In dem Maße, als es in den musikalischen Kräften
und Bewegungen geistige erfaßt, die Symbole „liest“, durchs Abbild zum Urbild schreitend, selbst Kraft und Bewegung werdend, sich fügend,
einharmonierend, wird es Wahrheit erkennen und Trug unterscheiden. Da sind wahre Maßstäbe, die nicht äußerlich erlernt werden, sondern im reinen Sein
in Gott sich von selbst erweisen. Als veräußerlichte werden sie wiederum abstrakt und kehren sich gegen die Wahrheit, so wie Christus, der wahre Gott, im
Namen des Gesetzes von den Frommen verurteilt worden ist. Was für das Große und Ganze des geistigen Weges gilt, gilt ebenso für das Kleine und die
einzelnen Teile. Kein Teil ist dem Heiligen angemessen, wenn es sich nicht harmonisch ins Ganze fügt; das Ganze ist unvollkommen, wo es nicht auch im
Teil sich wiederfindet. Das ist ja das Wesen der Harmonie, daß alle Teile sich dem Einen fügen und das Eine in jedem einzelnen leuchtet, wodurch das Teil
sein getrenntes Einzeldasein und alle Nichtigkeit verliert und zum Träger und Wahrbild des ganzen Einen wird. Auf den Menschen bezogen ist das:
Erlösung; auf die Dinge bezogen ist es Miterlösung, Heiligung. Was in keinem Lehrbuch der Musik beschrieben werden kann, kann durch die Übung des
heiligen Gesangs initiiert werden, sofern solche Übung eingebettet ist ins Ganze der überlieferungsgemäßen Herzensübung.
S. 89f
Die Begrenzungen hinsichtlich der Primzahlwerte für das Tonsystem des Kirchengesangs, zu denen wir im Kloster Buchhagen aufgrund unserer
eigenen Erfahrung gelangt sind, entsprechen offenbar den Möglichkeiten, die dem musikalischen Empfinden heute ganz allgemein gegeben sind. Die
Zusatzzeichen, mit denen neuerdings naturtönige Verschiebungen für Streichinstrumente in der üblichen europäischen Notenschrift kenntlich gemacht
werden, gehen ebenfalls von den Werten aus, wie sie bis zur 6. Oktave (32. bis 64. Teilton) erscheinen. Dort ist die 61 der höchste in Frage kommende
Primzahlenwert. Die Grenze der „nach Gehör stimmbaren Werte“ wird dort für naturtönige Intervalle, d.h. nicht nur obertönige, sondern auch andere
Naturintervalle, mit der Beteiligung der Primzahl 23 angegeben.
Unbeschadet dieser grundsätzlichen Möglichkeiten des Gehörs haben wir hinsichtlich des musikalischen Empfindens immer wieder Toleranzen
festgestellt, die bei verschiedenen Menschen unterschiedlich groß sind. Allgemein kann man sagen, daß die Toleranzen umso größer sind, je weniger jemand
musikalisch geschult ist; je feiner jemandes Gehör, umso geringer werden sie. Trotzdem werden die verschiedenen Qualitäten, wie beispielsweise der
Unterschied zwischen den Terzen 5/6 und 32/39, sogar von wenig geschulten Sängern deutlich als Farbunterschiede wahrgenommen, auch wenn einer die
betreffenden Töne noch nicht selbst gezielt ansingen kann. Sehr dicht beieinander liegende Intervalle hingegen werden als eine Qualität gehört. Es war z. B.
schwierig, die um 0,35 Lütt getrennt liegenden Werte der beiden weiten Durterzen 32/41 und 7/9 ohne Überprüfung auseinanderzuhalten; auch die weiten
Mollterzen 32/39 und 9/11 verschwimmen für den Hörer zu ein und derselben Intervallempfindung. Dabei scheint das Empfinden höherzahlige Werte mit
den unmittelbar benachbarten kleinzahlig bestimmten Intervallen zusammenzuziehen, so daß man geneigt sein könnte, von untergeordneten
Intervallräumen zu sprechen.
Vor diesem Hintergrund war es eine echte Überraschung, daß bei der klanglichen Überprüfung der Beugungen im Karischen im Jahr des Herrn 2012
die sehr dicht beieinander liegenden erhöhten Septimen 14/27 und 27/52 im musikalischen Zusammenhang völlig anders wirkten und keineswegs einfach
ausgetauscht werden konnten. Beide Werte waren rein empirisch aufgefunden worden, indem der Chorleiter das karische melismatische „große Ehre“ sang,
auf den Septimen stehenblieb und sodann die Tonhöhen mit dem Meßinstrument ermittelt wurden. Die 14/27 führt ganz eindeutig leittönig zur Oktave; die
nur 0,138 Lütt (2,4 Cent!) tiefer liegende 27/52 hingegen fügt sich als Wechselnote zur phrygischen Sexte 8/13. Diese unerwartete Eigenwilligkeit (und
Erkennbarkeit!) der Intervalle hängt offensichtlich mit den Primzahlqualitäten und ihren inneren Verwandschaftsverhältnissen zusammen. Der 14/27 liegt
eine quintige Saitenteilung zugrunde, welche leittönig nach oben zieht, indes die 27/52 in der 13-er Teilung gründet und dadurch mit der phrygischen Sexte
verwandt ist. Das wird noch verstärkt durch die Tatsache, daß im nächsten Umfeld dieser beiden Intervalle kein hervorstechender Wert liegt, der das
Tonempfinden auf sich hin söge. Bemerkenswert ist in diesem Zusammenhang die Tatsache, daß hier die Wirkung der Zahlenqualität und die durch sie
gestiftete Verwandschaft stärker auf unser musikalisches Empfinden wirkt als es der objektiv äußerst geringe Tonhöhenunterschied vermuten ließe.
Im Nahbereich der großen Intervallqualitäten hingegen scheint eine so feine Tonunterscheidung eingeschränkt zu sein. So hört man stets die
Qualität der phrygischen Sexte 8/13, auch wenn dicht danebenliegende Intervalle wie die 37/60 oder 35/57 erklingen. In einem verhältnismäßig engen
Raum, dessen Grenze spätestens bei einer Verschiebung um etwa ±0,3 Lütt erreicht wird, wird immer die Qualität des betreffenden Hauptintervalles
wahrgenommen. Und diese wird sinnvollerweise mit dem entsprechenden Intervallwert bezeichnet, der dann zugleich der natürliche Orientierungspunkt
innerhalb dieses Raumens ist. Das Phänomen des „Zurechthörens“ auf die starke Intervallqualität hin überlagert offensichtlich die Möglichkeit der
eigentlich viel genaueren musikalischen Unterscheidung, die in anderen Bereichen des Tonspektrums beobachtet werden kann. Doch tritt es wirklich nur in
unmittelbarer Nähe der großen Qualitäten auf. Ein Intervall wiederum, das in der Mitte zwischen zwei „Hauptintervallen“ liegt, z. B. zwischen der aiolischen
5/8 und der phrygischen 8/13 Sexte, rastet nicht mehr ein, sondern man empfindet es als vage, zwitterhaft und charakterlos; es möchte in die eine oder die
andere Richtung konkretisiert werden.
S. 114
Der Begriff der Harmonie ist ja keineswegs auf die Musik beschränkt; vielmehr lassen sich die Bildegesetze der Schöpfung, die ewigen Ordnungen
des Lebens, samt den geistigen Gesetzen, wie die Struktur alles Seienden überhaupt, in Zahlen fassen, welche ihrerseits, dank ihrer musikalischen Wertigkeit,
dem musikalischen Erleben des Menschen zugänglich sind. Durch das Singen heiliger Melodien, die in bestimmten Zahlenproportionen verlaufen, wurden
entsprechende geistige Mächte und Schöpfungskräfte „angerufen“ und verstärkt.
S. 120
Da die Seele nicht irdischen, sondern himmlischen Ursprungs ist, wird sie durch Hören und Üben heiliger Musik zu geistiger Schau geführt, erinnert
sich ihres göttlichen Ursprungs und fügt sich freudig in die himmlische Harmonie. Dadurch wird sie schließlich in den Stand versetzt, ihre eigentlich
göttliche Bestimmung auf Erden zu erfüllen. Dieser Gedanke der musikalischen Anagogie, der Hinanführung des Menschen zu höherem, gottgemäßen
Bewußtsein durch Gesang, wird später von den Kirchenvätern aufgegriffen und weitergeführt werden.
S. 150
Nach der Altväterüberlieferung besteht die Aufgabe des Menschen auf Erden darin, die von Gott angelegte Gestalt zu entfalten und zur Ähnlichkeit
zu gelangen. Nicht dem im Urirrtum abgespaltenen eigenen Willen, nicht dem Trug, sondern in Freiheit(!) dem Willen Gottes zu folgen, bedeutet, sich dem
göttlichen Sein einzuschmiegen, in Harmonie mit Gott und Seiner Schöpfung zu leben. Dies aber geschieht durch die Freude, durch jenes glückselige
Wohlgefallen, welches wir spüren, wo immer wahre Schönheit und Harmonie aufleuchtet. Das Ergötzen am Schöpfer, die Glückseligkeit in Gott, läßt die
Freude überschwenglich quellen, welche solcherart die Seele ordnet. Trug aber geschieht durch Verkürzung, durch Ausblenden des inneren geistigen Sinnes
und Zusammenhanges.
Jeder orthodoxe Tempel ist sowohl ein Symbol und Abbild des Kosmos als auch der inneren, geistigen Gestalt des Menschen. In seiner vollständigen
mystagogischen Gestalt zeichnet er, wie Maximos der Bekenner in seinem Werk über die Liturgie ausführt, den Aufstieg des Menschen zur geistigen Schau
vor, bis hin zur Vereinigung mit dem dreieinen Gott. Dementsprechend ist der heilige Gesang, den wir jeden Tag im Tempel darbringen, sowohl Lobpreis
und Verherrlichung Gottes, als auch Symbol und Abbild des überhimmlischen Gesangs der Engel. Und er ist Symbol und Abbild der kosmischen Klänge,
die ihrerseits als Bild des himmlischen Gesangs der Engel und Widerhall der ewigen schöpfungsmächtigen Liebes- und Lebenskräfte Gottes sind. Daher ist
der heilige Gesang ganz unabhängig davon, ob irgendein Irdischer ihn hört oder nicht, ob er der Mode oder dem Geschmack der Zeit entspricht oder nicht;
vielmehr soll er so selbstverständlich und von allem Irdischen gänzlich unbeeindruckt ertönen, wie die Sterne am Himmel stehen, die Planeten ihre Bahnen
ziehen und die Cherubim am himmlischen Throne ganz Auge und Gesang in Gott und für Gott sind. Damit der heilige Gesang diesem Urbilde so weit als
möglich entspricht, sollte er nicht nur im selben Geiste vollkommener Schau, Hingabe und Liebe in Gott wie bei den Engeln geschehen, sondern auch bis in
die greif- und hörbaren musikalischen Grundlagen hinein den geheiligten Bildegesetzen folgen, nach denen Gott die Schöpfung gebildet hat. Je reiner die
Ähnlichkeit mit dem Urbilde getroffen wird, um so eher wird der heilige Gesang in der Seele die Erinnerung an die ewigen urbildlichen Klänge erwecken, sie
reinigen, erheben und durch die himmlischen Sphären ins obere Heiligtum führen.
S. 151
Dementsprechend ist der heilige Gesang, den wir jeden Tag im Tempel darbringen, sowohl Lobpreis und Verherrlichung Gottes, als auch Symbol
und Abbild des überhimmlischen Gesangs der Engel. Und er ist Symbol und Abbild der kosmischen Klänge, die ihrerseits als Bild des himmlischen Gesangs
der Engel und Widerhall der ewigen schöpfungsmächtigen Liebes- und Lebenskräfte Gottes sind. Daher ist der heilige Gesang ganz unabhängig davon, ob
irgendein Irdischer ihn hört oder nicht, ob er der Mode oder dem Geschmack der Zeit entspricht oder nicht; vielmehr soll er so selbstverständlich und von
allem Irdischen gänzlich unbeeindruckt ertönen, wie die Sterne am Himmel stehen, die Planeten ihre Bahnen ziehen und die Cherubim am himmlischen
Throne ganz Auge und Gesang in Gott und für Gott sind. Damit der heilige Gesang diesem Urbilde so weit als möglich entspricht, sollte er nicht nur im
selben Geiste vollkommener Schau, Hingabe und Liebe in Gott wie bei den Engeln geschehen, sondern auch bis in die greif- und hörbaren musikalischen
Grundlagen hinein den geheiligten Bildegesetzen folgen, nach denen Gott die Schöpfung gebildet hat. Je reiner die Ähnlichkeit mit dem Urbilde getroffen
wird, um so eher wird der heilige Gesang in der Seele die Erinnerung an die ewigen urbildlichen Klänge erwecken, sie reinigen, erheben und durch die
himmlischen Sphären ins obere Heiligtum führen.
S. 179f
Nachdem die Musikentwicklung des Abendlandes bisher von der Einfachheit zur Vielheit fortgeschritten war, von den Schöpfungsgegebenheiten der
Klänge zu immer höherer Abstraktion, angefangen beim pythagoräischen symmetrischen Tetrachordrahmen, über die reinen Dreiklänge der Renaissance
und das barocke System des Quintenzirkels bis hin zur Temperatur, dann in immer höheres Differenzieren und Verschärfen der Klangwirkung unter
Einbeziehung aller im Tonsystem möglichen Dissonanzen und zuletzt zur Auflösung des Tonsystems in der Zwölftönigkeit, die zugleich seine folgerichtige
Vollendung darstellt, darnach in der elektronischen Musik zur Auflösung noch der Klänge in reine Sinustöne und deren willkürlichen Neukombination
gelangte, und schließlich auf der letzten Stufe Musik als solche überschreitend zur ästhetischen Meditation beliebiger Geräusche überging, gilt es nunmehr,
die Richtung grundsätzlich umzukehren von der Vielheit zur Einheit. Das bedeutet, völlig neu anzusetzen im denkbar Ältesten und zum Ursprung von
Musik überhaupt zurückzukehren. Man muß wieder den einen Ton betrachten, und zwar so, wie der Mensch ihn singt, einfach einen Ton, sonst nichts. Das
musikalische Erleben, welches sich an den Beziehungen der Töne zueinander entzündet, wird in äußerster Selbstbeschränkung zunächst auf die Prime, das
Verhältnis 1/1, zurückgenommen. Hier entdecken wir wieder, was im faszinierenden Kosmos der funktionalen Musik ganz in den Hintergrund gerückt war,
nämlich die Innenwelt des Tonklanges und seine geistigen und seelischen Entsprechungen. Wir gehen also vom aktiven Modus des Umbildens,
Neuschöpfens und Vorantreibens der musikalischen Entwicklung über in den passiven Modus des Hinlauschens, Empfangens, Gewahrens; von der Haltung
des Gebietens über die Dinge in die Haltung des Gehorsams und der Demut vor dem, was Gott gegeben hat. Dieser Moduswechsel entspricht dem
religiösen Begriff der Umkehr, und er gehört zu den unabweislichen Notwendigkeiten unserer Zeit, die bereits im Zeichen der Apokalypse steht. Doch geht
es dabei gar nicht um den Versuch, trotz allem irgendwie weiter zu machen, sondern im Gegenteil um das Loslassen allen Wollens außer einem: den Kern,
den Ursprung, den Sinn, die letzte Wahrheit zu erkennen und mit ihr eins zu werden. Wie in der Übung des Herzensgebetes gibt es nichts mehr zwischen
Mensch und Gott; da ist der eine Mensch und der eine Gott, und sich in Ihm vergessend und lassend wird er Gestalt (ὑπόστασις, persona) im Geheimnis
der Selbstentäußerung. Und wie die eine Eins zur anderen Eins steht und sich in geheimnisvoller Einheit erfährt, um solcherart zur ureigenen Gestalt sich zu
bilden, so kann auch nur aus der Einheit in Gott, aus der Eins, und nur befruchtet durch das heilige Wort Gottes sich Neues entfalten, das irgend Sinn
ergibt. Dabei ist es ganz uninteressant, ob es „neu“ oder „uralt“, wenn es nur wahr ist.
«In einer kleinen, mit Fresken ausgemalten Krypta feiern sie ihre Gottesdienste, und zwar in deutscher Sprache und mit Melodien, die aus den ältesten Traditionen schöpfen, aber denen die klanglichen und prosodischen Eigenarten des Deutschen zugrunde liegen. Daran hat Abt Johannes, studierter Kirchenmusiker und Religionswissenschaftler, über drei Jahrzehnte gearbeitet.»
Weitere Leseausschnitte als PDF zum Herunterladen:
Der Weg zum naturtönigen Kultgesang, Leseprobe Ss. 3-20
Der Weg zum naturtönigen Kultgesang, Leseprobe Ss. 47-51
Der Weg zum naturtönigen Kultgesang, Leseprobe Ss. 88-90
Der Weg zum naturtönigen Kultgesang, Leseprobe Ss. 110-114
Der Weg zum naturtönigen Kultgesang, Leseprobe Ss. 179-180
Der Weg zum naturtönigen Kultgesang, Leseprobe Ss. 189-190
Der Weg zum naturtönigen Kultgesang, Leseprobe Ss. 234-235
Der Weg zum naturtönigen Kultgesang, Leseprobe Ss. 262-263
Der Weg zum naturtönigen Kultgesang
Musikalisch-philosophisches Lehrbuch zum Deutschen Choral.
280 Seiten, Ganzledereinband mit Goldprägung,
Format 17 x 24,5 cm. ISBN 978-3-926236-09-8 € 35,-
➥ Bestellzettel
➥ zurück zur Übersicht

